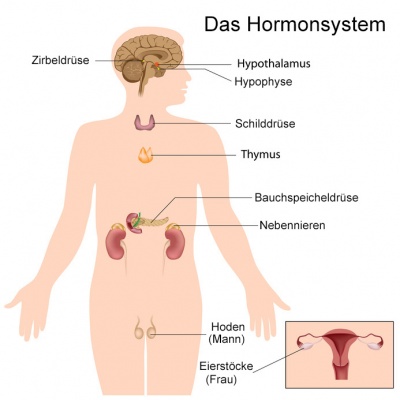Cholecystokinin
 Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher
Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer. nat. Frank Meyer
Letzte Aktualisierung am: 26. Februar 2025Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.
Sie sind hier: Startseite Laborwerte Cholecystokinin
Cholecystokinin (veraltet: Pankreozymin, kurz auch CCK) ist ein Hormon, das hauptsächlich im Magen-Darm-Trakt vorkommt. Ins Deutsche übersetzt bedeutet Cholecystokinin „Gallenblasenbeschleuniger“. Schon der Name deutet damit an, dass Cholecystokinin eine maßgebliche Rolle bei der menschlichen Verdauung spielt.
Inhaltsverzeichnis |
Was ist Cholecystokinin?
CCK ist ein Hormon, welches im menschlichen Körper eine wesentliche Rolle bei der Verdauung einnimmt. Die Ausschüttung des Hormons wird durch in der Nahrung enthaltene Fett- und Aminosäuren angeregt. Der Ort der Entstehung von CCK ist der Zwölffinger- und der Leerdarm.
CCK löst ein physiologisches Sättigungsgefühl aus. Es ist außerdem verantwortlich für die Bildung des zur Zersetzung des Nahrungsbreis notwendigen Sekrets aus der Bauchspeicheldrüse. Die Kontraktion der Gallenblase – ebenfalls unabdingbar für die Verdauung – wir ebenfalls durch CCK ausgelöst.
Wofür braucht der Körper Cholecystokinin?
Cholecystokinin (CCK) ist ein Hormon und Neurotransmitter, das eine zentrale Rolle in der Verdauung und Appetitregulation spielt. Es wird hauptsächlich in den Zellen des Dünndarms, insbesondere im Duodenum und Jejunum, als Reaktion auf den Kontakt mit Fetten und Proteinen freigesetzt.
Eine der wichtigsten Funktionen von CCK ist die Stimulation der Gallenblase, die sich daraufhin zusammenzieht und Galle in den Dünndarm freisetzt. Die Galle hilft bei der Emulgierung und Verdauung von Fetten. Gleichzeitig regt CCK die Sekretion von Verdauungsenzymen aus der Bauchspeicheldrüse an, die für die Aufspaltung von Fetten, Proteinen und Kohlenhydraten erforderlich sind.
CCK beeinflusst auch die Magenentleerung, indem es die Beweglichkeit des Magens verlangsamt. Dies führt zu einem verzögerten Übergang des Speisebreis in den Dünndarm, was die Verdauung und Nährstoffaufnahme verbessert. Zudem wirkt CCK auf das Zentralnervensystem und trägt zur Appetithemmung bei. Es sendet Signale an das Gehirn, die ein Sättigungsgefühl vermitteln und so die Nahrungsaufnahme reduzieren.
Darüber hinaus hat CCK neuroprotektive Funktionen und spielt eine Rolle in der Stressregulation sowie in der Schmerzwahrnehmung. Aufgrund seiner vielfältigen Wirkungen ist es ein wichtiger Regulator des Verdauungssystems und des Energiestoffwechsels.
Produktion, Herstellung & Bildung
CCK wird im Zwölffingerdarm (Duodenum) und im Leerdarm gebildet. Sobald die Nahrung aus dem Magen in den Zwölffingerdarm gelangt – der Zwölffingerdarm ist der erste Abschnitt des Dünndarms, der direkt an den Magen grenzt und vom Magenpförtner verschlossen wird – beginnt dieser mit der „Untersuchung“ des Nahrungsbreis.
Sofern Fettsäuren mit einer Länge von mindestens 12 Kohlenstoffatomen vorhanden sind, beginnt der Zwölffingerdarm mit der Bildung von CCK. Durch die Ausschüttung wird zunächst die weitere Entleerung von Mageninhalt in den Zwölffingerdarm gehemmt. Außerdem regt das CCK die endokrinen Zellen – das sind Zellen, die Enzyme bilden und nach außen abgeben – der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) an, Verdauungsenzyme zu bilden.
Die Bauchspeicheldrüse setzt die Verdauungsenzyme in den Zwölffingerdarm ab, dort beginnen sie mit der Zersetzung von Eiweißen, Kohlenhydraten und Fetten. Im Anschluss an die erste Zersetzung der Nahrung im Zwölffingerdarm wird die Nahrung weiter transportiert Richtung Leerdarm (Jejunum). Der Leerdarm schließt sich unmittelbar an den Zwölffingerdarm an und mündet in den Krummdarm.
Im Leerdarm wird wiederum CCK gebildet, welches eine Kontraktion der Gallenblase auslöst. In der Gallenblase verwahrt der menschliche Körper die von der Leber produzierte Galle, ein Sekret, das der Darm für die Verdauung von Fetten benötigt. Die durch das CCK ausgelöste Kontraktion der Gallenblase setzt das Sekret frei.
Funktion, Wirkung & Eigenschaften
CCK wird im Wesentlichen für die menschliche Verdauung benötigt. Bereits nach Eintritt in den Zwölffingerdarm hemmt es zunächst die Ausschüttung weiterer Nahrung in den Darm. Bei entsprechendem Füllstand signalisiert es dem menschlichen Hirn ein Sättigungsgefühl.
Erst wenn die erste Portion den Zwölffingerdarm verlassen hat, kann neuer Nahrungsbrei nachfließen. Das CCK bewirkt außerdem, dass die Bauchspeicheldrüse mit der Bildung von Verdauungsenzymen beginnt. Die Bauchspeicheldrüse gibt das gebildete Sekret in den Zwölffingerdarm ab, dort beginnen die Enzyme mit der Zersetzung der Nahrung.
Im Weiteren passiert die Nahrung den Leerdarm. Auch dort wird CCK gebildet und löst eine Kontraktion der Gallenblase aus. Das dort gelagerte Gallensekret wird ebenfalls zur Aufspaltung der Nahrung – insbesondere von langkettigen Fetten – benötigt. CCK spielt damit eine zentrale Rolle bei der Aufnahme und Verwertung von Nahrungsmitteln. Durch seine sättigungsauslösende Wirkung reguliert es außerdem die Nahrungsaufnahme hinsichtlich der Menge.
Wie hoch sind normale Referenzwerte
Für Cholecystokinin (CCK) gibt es keine festen Referenzwerte für die tägliche Zufuhr, da es sich um ein körpereigenes Hormon handelt, das im Dünndarm und im zentralen Nervensystem synthetisiert wird. Die Konzentration von CCK im Blut variiert je nach Nahrungsaufnahme und physiologischen Bedingungen.
In klinischen Untersuchungen werden CCK-Plasmaspiegel in Pikogramm pro Milliliter (pg/ml) gemessen. In nüchternem Zustand liegt der Normalwert meist zwischen 0,5 und 2,0 pg/ml. Nach einer fettreichen oder proteinreichen Mahlzeit kann der Wert auf 5–15 pg/ml oder mehr ansteigen, da CCK als Reaktion auf Nahrungsfette und Aminosäuren freigesetzt wird.
Individuelle Schwankungen sind normal, da die CCK-Produktion durch die Zusammensetzung der Nahrung, die Darmgesundheit und hormonelle Faktoren beeinflusst wird. Ein stark erhöhter oder erniedrigter CCK-Spiegel kann jedoch auf Verdauungsstörungen, Gallenblasenprobleme oder eine gestörte Sättigungsregulation hindeuten.
Eine gezielte Erhöhung der CCK-Ausschüttung kann durch eine Ernährung mit gesunden Fetten, Proteinen und Ballaststoffen gefördert werden, da diese Substanzen die Ausschüttung des Hormons anregen. Direkte Zufuhr von CCK über Nahrungsergänzungsmittel ist nicht üblich, da der Körper es selbst synthetisiert.
Kann zu viel Cholecystokinin schaden?
Parse error: syntax error, unexpected '<' in /www/htdocs/w00dc833/symptomat/extensions/SecurePHP/SecurePHP.body.php(65) : eval()'d code on line 1
CCK spielt eine zentrale Rolle bei der Aufnahme und der Verarbeitung von Nahrungsmitteln. Sofern die Ausschüttung von CCK nicht im erforderlichen Gleichgewicht stattfindet, klagt der Mensch über verschiedene Beschwerden.
Schon die Nahrungsaufnahme kann bei einer Unterversorgung mit CCK problematisch sein, etwa dann, wenn dem Gehirn kein ausreichendes Sättigungsgefühl vermittelt wird. In diesem Fall essen die Menschen zu viel und beklagen ein fehlendes „Jetzt ist es genug“-Gefühl. Je nach Stärke des Mangels kann Fettsucht (Adipositas) die Folge sein. Der Zusammenhang zwischen CCK-Mangel und Fettsucht konnte in mehreren Tierversuchen nachgewiesen werden.
Ein Zusammenhang zwischen CCK-Mangel und Bulimie (Ess-Brechsucht) wird ebenfalls vermutet. Ausgelöst durch CCK-Mangel leiden an Bulimie Erkrankte unter massiven Heißhungerattacken, die sie nicht steuern können. Das anschließende Völlegefühl im Magen zwingt zum Erbrechen. CCK-Mangel kann auch bei normaler Ernährungsweise ein unangenehmes Völlegefühl verursachen, dem nur durch Erbrechen Abhilfe geschaffen werden kann.
Ein Mangel an CCK kann auch dazu führen, dass die Abgabe von Nahrung in den Zwölffingerdarm nicht gleichmäßig gesteuert wird. Aufgenommene Nahrung verbleibt zu lange im Magen und fließt zurück in die Speiseröhre. Sodbrennen ist die unangenehme und gefährliche Folge des CCK-Mangels.
Wird aufgrund der ungenügenden CCK-Ausschüttung nicht genügend Enzyme aus Bauchspeicheldrüse und Gallenblase abgegeben, kann der Mensch die Nahrung nur unzureichend zersetzen. Es konnte beobachtet werden, dass sich die aufgenommene Energie bei ausgeprägtem CCK-Mangel um bis zu 9% reduziert.
Tipps für eine optimale Versorgung mit Cholecystokinin
Gesunde Fette in die Ernährung integrieren
Cholecystokinin (CCK) wird als Reaktion auf die Aufnahme von Fetten freigesetzt. Der Konsum von gesunden Fetten wie Avocados, Nüssen, Olivenöl und fettem Fisch (z. B. Lachs) kann die Ausschüttung von CCK fördern und die Fettverdauung verbessern.
Proteinreiche Mahlzeiten essen
Proteine sind ein starker Stimulator für die CCK-Ausschüttung. Hochwertige Proteinquellen wie Eier, Hülsenfrüchte, mageres Fleisch, Fisch und Milchprodukte helfen, den CCK-Spiegel auf einem gesunden Niveau zu halten und das Sättigungsgefühl zu fördern.
Ballaststoffe für eine langsamere Verdauung
Ballaststoffe verlangsamen die Magenentleerung, was zu einer verlängerten CCK-Freisetzung führt. Gemüse, Vollkornprodukte, Leinsamen und Hülsenfrüchte sind reich an Ballaststoffen und unterstützen eine gesunde Verdauung.
Langsames und bewusstes Essen
Die Ausschüttung von CCK erfolgt nicht sofort, sondern setzt verzögert ein. Wer langsam isst und gründlich kaut, gibt dem Körper Zeit, das Sättigungssignal zu senden, was übermäßiges Essen verhindert.
Regelmäßige Mahlzeiten einhalten
Unregelmäßige Essgewohnheiten können die Hormonbalance stören. Wer regelmäßig isst, fördert eine gleichmäßige Produktion von Verdauungshormonen, darunter CCK, und unterstützt so eine stabile Verdauungsfunktion.
Verzicht auf hochverarbeitete Lebensmittel
Stark verarbeitete Lebensmittel mit viel Zucker und raffinierten Kohlenhydraten können die natürliche CCK-Ausschüttung beeinträchtigen, da sie schnell verdaut werden und kaum sättigende Nährstoffe enthalten. Eine vollwertige, natürliche Ernährung ist empfehlenswert.
Genügend Flüssigkeit aufnehmen
Wasser und ungesüßte Tees helfen bei der Verdauung und können indirekt die CCK-Ausschüttung unterstützen, indem sie den Magen-Darm-Trakt gesund halten. Stark zuckerhaltige Getränke oder Alkohol sollten hingegen reduziert werden.
Regelmäßige Bewegung in den Alltag integrieren
Körperliche Aktivität, insbesondere moderater Ausdauersport und Krafttraining, kann die Empfindlichkeit der Verdauungshormone verbessern. Bewegung unterstützt zudem eine bessere Nährstoffverwertung und Sättigung.
Stress reduzieren
Chronischer Stress kann die Freisetzung von CCK beeinträchtigen und Verdauungsprobleme verursachen. Entspannungstechniken wie Meditation, Atemübungen oder Spaziergänge können helfen, das hormonelle Gleichgewicht zu erhalten.
Gute Schlafqualität sicherstellen
Eine ausreichende und erholsame Nachtruhe ist entscheidend für die hormonelle Balance. Zu wenig Schlaf kann die Produktion von Verdauungshormonen stören und das Hungergefühl erhöhen, was sich negativ auf die CCK-Ausschüttung auswirken kann.
Quellen
- Braun, J., Dormann, A .J.: Klinikleitfaden Innere Medizin. Urban & Fischer, München 2013
- Clark, D.P.: Molecular Biology: Das Original mit Übersetzungshilfen. Spektrum Akademischer Verlag., Heidelberg 2006
- Marischler, C.: BASICS Endokrinologie. Urban & Fischer, München 2013