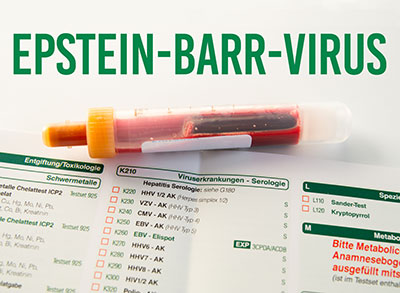Epstein-Barr-Virus
 Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher
Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer. nat. Frank Meyer
Letzte Aktualisierung am: 24. Februar 2025Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.
Sie sind hier: Startseite Krankheitserreger Epstein-Barr-Virus
Das Epstein-Barr-Virus, kurz EBV wird in der Medizin auch als Humanes-Herpes-Virus 4 bezeichnet. Es gehört zur Gruppe der Herpesviren und wurde von Michael Epstein und Yvonne Barr erstmal 1964 beschrieben.
Inhaltsverzeichnis |
Was ist das Epstein-Barr-Virus?
Beim Epstein-Barr-Virus handelt es sich um einen Erreger, der Auslöser für das Pfeiffer´sche Drüsenfieber, also einer fieberhaften Erkrankung mit Kopf- und Gliederschmerzen ist. Das Virus wird per Tröpfcheninfektion übertragen, was der Krankheit im Volksmund den Namen „Kusskrankheit“ eingebracht hat.
Eine akute Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus lässt sich über entsprechende Blutuntersuchungen (entweder per Direktnachweis des Virus oder serologische Antikörperbestimmungen) eindeutig feststellen.
Bedeutung & Funktion
Die Ansteckung mit dem Epstein-Barr-Virus kann über das Blut, Schleimhautkontakte oder den Speichel erfolgen. Aus diesem Grund ist eine Ansteckung nicht nur beim Küssen, sondern auch bei normalen Haut- und Handkontakten möglich. Die Viren können auch außerhalb des menschlichen Körpers bis zu drei Tage überleben, abhängig vom jeweiligen Umgebungsmilieu. Als Haupteintrittspforten für den Erreger kommen die Nasen- und Augenschleimhäute sowie der Mund in Frage. An diese Stellen gelangen sie in der Regel über die Hände des Betroffenen.
Grundsätzlich lässt sich die Erkrankung mit dem Epstein-Barr-Virus in einen akuten und einen chronischen Zustand unterscheiden. Gegenüber der akuten Erkrankung ist der serologische Antikörperbefund bei der chronischen Verlaufsform vielfach weniger eindeutig. Häufig sind bei der chronischen Form nur geringe Mengen einzelner Langzeitantikörper im Serum des Blutes vorhanden, die auch nach einer akuten Infektion dauerhaft im Blut enthalten sind.
Sehr viel aussagekräftiger als der übliche Antikörpertest ist der Direktnachweis der Viren im Blut des Betroffenen. Hierdurch lässt sich eine chronische Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus zuverlässig diagnostizieren.
Die aktuelle Immunlage des Körpers ist entscheidend dafür, ob und wie stark der Betroffene nach einer Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus Krankheitssymptome zeigt. Somit muss eine Infektion bei einem intakten und starken Immunsystem keineswegs zwangsläufig zu einer Erkrankung führen. Sollte das Immunsystem des Betroffenen jedoch bereits geschwächt sein, können die Epstein-Barr-Viren ohne große Gegenwehr einzelne Körperregionen oder auch den gesamten Körper des Betroffenen befallen, wodurch sich verschiedene Symptome erklären lassen.
Biologische Eigenschaften
Das Epstein-Barr-Virus (EBV) gehört zur Familie der Herpesviridae und wird als Humanes Herpesvirus 4 (HHV-4) klassifiziert. Es zählt zur Unterfamilie der Gammaherpesvirinae und zur Gattung Lymphocryptovirus. EBV ist weltweit verbreitet und infiziert bevorzugt B-Lymphozyten, kann aber auch Epithelzellen betreffen.
Morphologisch besitzt EBV eine ikosaedrische Kapsidstruktur, die aus 162 Kapsomeren besteht. Das Virus ist etwa 120–180 nm groß und von einer Lipidmembran umhüllt, die virale Glykoproteine enthält, die für die Zellfusion und den Eintritt in Wirtszellen notwendig sind. Die Vermehrung erfolgt im Zellkern der infizierten Zellen, wobei EBV zwischen einer lytischen und einer latenten Phase wechseln kann. Während der latenten Phase bleibt das Virus in B-Zellen verborgen und kann lebenslang persistieren.
Das EBV-Genom ist doppelsträngige DNA mit einer Länge von etwa 172 kbp. Es enthält mehrere Gene, darunter EBNA (Epstein-Barr Nuclear Antigens) und LMP (Latent Membrane Proteins), die für die Zelltransformation und Immunevasion entscheidend sind. Eine Besonderheit des Genoms ist seine Fähigkeit, als episomale DNA im Zellkern zu verbleiben, wodurch es die Zelle langfristig beeinflussen und onkogene Prozesse auslösen kann, insbesondere bei Immunsuppression oder genetischer Prädisposition.
Vorkommen & Verbreitung
Das Epstein-Barr-Virus (EBV) ist ein weltweit verbreitetes Virus und infiziert einen Großteil der menschlichen Bevölkerung. Schätzungen zufolge tragen etwa 90–95 % der Erwachsenen das Virus latent in sich. EBV kommt ausschließlich im Menschen vor und hat kein freies Umweltreservoir, da es auf lebende Zellen angewiesen ist, um zu überleben und sich zu vermehren.
Die Hauptübertragungswege sind der Speichelkontakt (z. B. Küssen, gemeinsames Benutzen von Besteck oder Gläsern) sowie selten Bluttransfusionen oder Organtransplantationen. Die Erstinfektion erfolgt häufig im Kindesalter und verläuft meist asymptomatisch. Bei Jugendlichen oder Erwachsenen kann sie jedoch Pfeiffersches Drüsenfieber (Mononukleose) auslösen.
In der Umwelt ist EBV nicht stabil, da es eine Lipidmembran besitzt, die außerhalb des Körpers schnell durch Austrocknung oder Desinfektionsmittel zerstört wird. Anders als einige Bakterien oder Pilze ist EBV kein Bestandteil der natürlichen Darmflora und spielt keine direkte Rolle in mikrobiellen Ökosystemen. Dennoch kann es durch seine lebenslange Persistenz im menschlichen Körper und seine Fähigkeit, das Immunsystem zu modulieren, indirekt die Zusammensetzung der mikrobiellen Flora beeinflussen.
In ökologischer Hinsicht ist EBV ein klassisches Beispiel für ein koevolutionäres Virus, das sich an seinen menschlichen Wirt angepasst hat, um eine langfristige, meist symptomfreie Koexistenz zu ermöglichen.
Krankheiten
Besonders häufig vom Epstein-Barr-Virus betroffen sind das Gehirn, die Leber, die Muskeln und Gelenke sowie bestimmte Nerven und Organe, jedoch auch das Blut respektive die roten und weißen Blutkörperchen. Die Intensität der jeweiligen Symptome ist stark von der Psyche und Gesamtverfassung des Körpers des Betroffenen abhängig. Aus diesem Grund lassen sich bei Betroffenen entweder permanent dieselben Beschwerden beobachten oder bestimmte Phasen, in denen sich der Erkrankte deutlich besser fühlt.
Folgende Symptome sind nach der Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus besonders häufig zu beobachten:
- Kopfschmerzen (Infektion der verschiedenen Großhirnbereiche)
- Schwindel (Infektion des Hör- und Gleichgewichtsnervs oder des Gleichgewichtsorgans)
- epileptische Anfälle (Infektion verschiedener Gehirnbereichen)
- psychische Beeinträchtigungen (Infektion von verschiedenen Gehirnbereichen)
- eine leicht erhöhte Körpertemperatur, die teilweise bis 38 Grad ansteigen kann (besonders bei Kindern durch eine Infektion des Temperaturzentrums im Gehirn)
- mehr oder weniger ausgeprägte Konzentrations- und Aufmerksamkeitsdefizite
- Ein- und Durchschlafprobleme
- Chronische Müdigkeit und dauerhafte Erschöpfung
- Nervenschmerzen (Infektion der verschiedenen hochsensiblen Nerven)
- Störungen der Schilddrüse (Unter- oder Überfunktion)
- Herzrhythmusstörungen, Herzklopfen oder Herzschmerzen (Infektion des Herzmuskels oder des Reizleitungssystems)
- Funktionsstörungen der Leber mit Ausscheidungsstörungen für Umweltgifte und Stoffwechselendprodukt (entweder mit oder ohne erhöhte Leberwerte)
- Vergrößerung der Milz
- akute oder chronische Nierenbeschwerden, beispielsweise in Form von Nierenschmerzen oder Blut im Urin
- Schwellungen der Lymphknoten
- rheumaähnliche Beschwerden der Gelenke
- Veränderungen im Blutbild (Zerstörung von verschiedenen Blutkörperchen; in Extremfällen kann es auch zu einer Verminderung aller Blutkörperchen kommen)
- Schmerzen in den Eierstöcken
Selbstverständlich können alle oben aufgeführten Symptome grundsätzlich auch mit anderen Krankheiten in Verbindung gebracht werden. Aus diesem Grund ist eine eindeutige Diagnose des Epstein-Barr-Virus von großer Bedeutung, um geeignete Therapiemaßnahmen in die Wege leiten zu können. Vielfach haben betroffene Personen bereits eine wahre Ärzteodyssee hinter sich bringen müssen, ehe die richtige Diagnose getroffen werden konnte.
Behandlungsmöglichkeiten
Eine spezifische antivirale Therapie gegen das Epstein-Barr-Virus (EBV) existiert derzeit nicht. Die Behandlung richtet sich hauptsächlich nach den Symptomen und der Krankheitsform. Bei einer milden Infektion wie dem Pfeifferschen Drüsenfieber erfolgt die Therapie symptomatisch mit Ruhe, Flüssigkeitszufuhr, Schmerzmitteln (z. B. Paracetamol, Ibuprofen) und Fiebersenkern. Antibiotika sind wirkungslos, da es sich um ein Virus handelt.
Bei schweren Verläufen oder EBV-assoziierten Erkrankungen wie Posttransplantations-Lymphomen (PTLD) oder EBV-assoziierten Karzinomen werden Virostatika wie Ganciclovir, Acyclovir oder Valganciclovir eingesetzt. Diese zeigen jedoch nur begrenzte Wirksamkeit, da EBV hauptsächlich in latenter Form persistiert und in dieser Phase schwer angreifbar ist.
Eine Herausforderung besteht in der Behandlung von resistenten Stämmen oder EBV-assoziierten Tumoren, bei denen die Standardtherapie nicht ausreicht. In solchen Fällen werden monoklonale Antikörper (z. B. Rituximab gegen B-Zellen) oder Zytostatika zur Hemmung der infizierten Zellen eingesetzt.
Neue experimentelle Ansätze umfassen T-Zell-Therapien, bei denen patienteneigene Immunzellen modifiziert werden, um EBV-infizierte Zellen gezielt zu eliminieren. Zudem werden CRISPR-Cas9-basierte Methoden zur gezielten Inaktivierung des viralen Genoms erforscht. Auch EBV-spezifische Impfstoffe sind in der Entwicklung, um zukünftige Infektionen oder Reaktivierungen zu verhindern.
Epstein-Barr-Virus und seine Rolle bei Krebs
Das Epstein-Barr-Virus (EBV) ist eines der wenigen bekannten Onkoviren, die direkt mit der Entstehung bestimmter Krebsarten in Verbindung gebracht werden. Durch seine Fähigkeit, in infizierten Zellen zu persistieren und das Immunsystem zu umgehen, kann EBV die Zellproliferation fördern und zur Tumorbildung beitragen. Besonders betroffen sind B-Zellen des Immunsystems, aber auch Epithelzellen können transformiert werden.
EBV-assoziierte Krebserkrankungen
EBV ist mit mehreren bösartigen Tumorerkrankungen assoziiert. Dazu gehören das Burkitt-Lymphom, ein aggressiver B-Zell-Tumor, der vor allem in Afrika auftritt, sowie das Hodgkin-Lymphom, das weltweit vorkommt. Besonders bei immungeschwächten Personen, wie AIDS-Patienten oder Empfängern von Organtransplantaten, kann EBV eine Rolle bei der Entstehung des posttransplantationsassoziierten Lymphoms (PTLD) spielen.
Darüber hinaus wird EBV mit bestimmten Karzinomen in Verbindung gebracht, insbesondere dem Nasopharynxkarzinom, das vor allem in Südostasien verbreitet ist. Auch einige Magenkarzinome (EBV-assoziiertes Magenkarzinom) weisen Spuren des Virus in den Tumorzellen auf. Die genaue Mechanik der Krebsentstehung durch EBV ist noch nicht vollständig verstanden, jedoch spielen virale Proteine wie EBNA-1, LMP-1 und LMP-2 eine Rolle bei der unkontrollierten Zellteilung und der Hemmung des programmierten Zelltods (Apoptose).
Mechanismen der Krebsentstehung
EBV kann in infizierten Zellen in verschiedenen Latenzstadien verbleiben. Dabei verändert es die Expression viraler Gene je nach Zelltyp und Immunsystemstatus des Wirts. Die Proteine LMP-1 und LMP-2 wirken als Onkoproteine, indem sie Signalwege aktivieren, die das Zellwachstum fördern und das Immunsystem unterdrücken. EBNA-1 verhindert die Erkennung des Virus durch das Immunsystem und sorgt für die Aufrechterhaltung des viralen Genoms in der Wirtszelle.
Therapeutische Ansätze
Die Behandlung EBV-assoziierter Krebserkrankungen hängt vom Tumortyp ab. Standardtherapien wie Chemotherapie, Bestrahlung und monoklonale Antikörper (z. B. Rituximab) werden häufig eingesetzt. Neuere Ansätze konzentrieren sich auf Immuntherapien, die EBV-spezifische T-Zellen aktivieren, um infizierte Zellen gezielt zu zerstören. In der Forschung stehen auch CRISPR-Cas9-basierte Geneditierung und mRNA-Impfstoffe gegen EBV als vielversprechende Möglichkeiten zur Prävention und Behandlung EBV-assoziierter Krebserkrankungen.
Quellen
- Doerfler, W.: Viren. Fischer Taschenbuch, Berlin 2015
- Hofmann, F., Tiller, F.,W.: Praktische Infektiologie. ecomed-Storck, Hamburg 2011
- Neumeister, B., Geiss, H., Braun, R.: Mikrobiologische Diagnostik. Thieme, Stuttgart 2009