Nierenerkrankungen
 Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher
Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer. nat. Frank Meyer
Letzte Aktualisierung am: 11. April 2024Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.
Sie sind hier: Startseite Krankheiten Nierenerkrankungen
Nierenerkrankungen werden häufig unterschätzt. Die Nieren des menschlichen Körpers erfüllen eine Vielzahl lebenswichtiger Funktionen. Dazu gehören u.a. die Regulierung des Wasserhaushalts, des Blutdrucks und des Säure-Basen-Gleichgewichts.
Inhaltsverzeichnis |
Was sind Nierenerkrankungen?
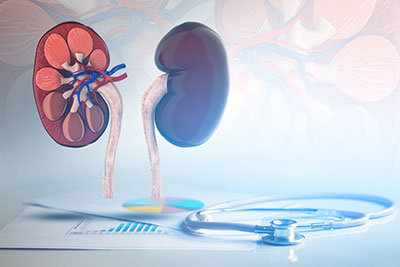
© krispetkong – stock.adobe.com
Nierenerkrankungen können lebensbedrohlich sein. Sie entstehen bei einer Störung der Funktionsfähigkeit der Nieren mit der Folge, dass diese nicht mehr richtig arbeiten. In schwerwiegenden Fällen kommt es zu einer Niereninsuffizienz. Das bedeutet, dass die Nieren in der den Menschen lebenserhaltenden Funktionen versagen. Dies kann auf chronische oder akute Weise geschehen. Dabei müssen nicht zwangsläufig immer beide Nieren von einer Unterfunktion betroffen sein.
Ursachen
Die Ursachen einer akuten und chronischen Niereninsuffizienz sind vielfältig und sehr unterschiedlich. Das akute Nierenversagen äußert sich in einer plötzlichen Mangeldurchblutung der Nieren. Die mangelnde Durchblutung kann durch einen plötzlich eintretenden Blutverlust, einen Abfall des Blutdrucks oder einen Kreislaufschock entstehen.
Daneben gehören auch mögliche Vergiftungen oder andere schädigende Einwirkungen auf die Nieren. Das Gewebe der Nieren kann auch durch die Einnahme von Medikamenten oder durch Pilze im Körper geschädigt werden, was ein akutes Nierenversagen zur Folge haben kann.
Wer beispielsweise kontinuierlich zu wenig Flüssigkeit zu sich nimmt und sich falsch ernährt, trägt zu der Entstehung von Nierensteinen bei, die neben möglichen Blasensteinen oder Harnsteinen weitere Ursachen für eine Niereninsuffizienz sein können.
Ist der menschliche Organismus von einem Tumor betroffen, so ist das Augenmerk stets auf die Funktion der Nieren zu richten. Denn ein Tumor kann ein sofortiges Nierenversagen verursachen.
Entzündungen der Nieren entstehen häufig durch bereits vorliegende Krankheiten, die den menschlichen Körper auf viele Weise schwächen. Erkrankungen wie Diabetes, Hepatitis, Krebs, Autoimmunerkrankungen oder Herzentzündungen können zu einer Funktionsstörung einer oder beider Nieren führen.
Eine Nierenerkrankung kann jedoch auch erblich bedingt sein. Das ist bei Nierenzysten oft der Fall. Erst bei vorliegen mehrerer Zysten kann es zu einer Beeinträchtigung der Funktionstüchtigkeit der Nieren kommen. In diesem Fall wird von einer Zystenniere gesprochen, die umgehen therapiert werden sollte.
Symptome, Beschwerden und Anzeichen
Grundsätzlich äußern sich die ersten Symptome in einer Veränderung des Urins. Die Veränderung kann sich in der Urinmenge oder ihrer Farbe zeigen. Im ersten Fall kann es entweder zu extrem verminderten oder einer stark erhöhten Urinmenge kommen u.U. verbunden mit einer farblichen Trübung oder Blut im Urin.
Entzündliche Reaktionen in der Nierentätigkeit können sich besonders in Folgeerkrankungen äußern. Das Hauptsymptom einer beeinträchtigten Arbeit der Nieren jedoch ist das vollständige Fehlen oder eine eingeschränkte Harnproduktion.
Infolge der Störung der Funktionsfähigkeit der Nieren können Stoffwechselprodukte und Giftstoffe nicht mehr aus dem menschlichen Organismus ausgeschieden werden. Dies muss sich am Anfang nicht direkt äußern und der Betroffene merkt erst nichts davon. Gerade eine chronische Niereninsuffizienz bleibt anfangs übersehen, weil diese zunächst ohne Symptome verläuft.
Erst im fortschreitenden Krankheitsverlauf bzw. in der fortschreitenden Störung der Nierentätigkeit können sich folgende Symptome äußern:
- Wassereinlagerungen (Ödeme) in den Beinen oder in der Lunge
- erhöhte Konzentration von bestimmten Stoffwechselprodukten im Blut. Dazu zählen beispielsweise Kreatinin, Harnstoff oder Harnsäure
Es gibt unspezifische Symptome, die auf andere Krankheitsbilder passen. Sie können aber auch auf eine Störung der Nierenfunktion hinweisen.
- vermehrte Kopfschmerzen
- kein Hungergefühl
Komplikationen
Bei einem akuten Nierenversagen können sich Komplikationen auf das gesamte Organsystem des menschlichen Körpers ausweiten. Komplikationen können besonders die Lunge, das Herz oder das Gehirn betreffen.
Lunge: Es kann zu einem Lungenödem kommen, was umgangssprachlich auch Wasserlunge genannt wird. In diesem Fall tritt aus den kleinsten Gefäßen Blutflüssigkeit aus. Diese Flüssigkeit fließt in den Zellzwischenraum und in die Lungenbläschen des Menschen. Dadurch wird eine ausreichende Aufnahme von Sauerstoff in den Blutkreislauf verhindert. Der Betroffene gerät in Luftnot, bekommt u.U. eine rasselnde Atmung oder einen schaumigen Auswurf.
Herz: Es kann zu einer Herzinsuffizienz kommen. Bei bestehendem Bluthochdruck im Kreislauf des Körpers kann es zu einer arteriellen Hypertonie bzw. Bluthochdruck im Lungenkreislauf kommen. Das bedeutet, dass der Blutdruck in den arteriellen Gefäßen chronisch erhöht ist. Die Herzinsuffizienz kann im Falle einer Störung der Nierentätigkeit auch infolge einer Überwässerung entstehen.
Die Herzstörung kann zu einer Rückstauung in den venösen Kreislauf führen, mit den möglichen Folgen einer Magenschleimhautentzündung, der Entstehung eines Geschwürs oder eines Blutverlustes in den Innenraum des Verdauungstraktes.
Gehirn: Bei einem Hirnödem bzw. der Wassereinlagerung im Gehirn, kann es zu neurologischen Komplikationen kommen. Dies kann Krampfanfälle oder eine eingeschränkte Aufmerksamkeit nach sich ziehen.
Wann sollte man zum Arzt gehen?
Das Problem ist, dass sich in der Anfangsphase einer Nierenstörung zunächst keine Symptome äußern. Das Vorliegen unspezifischer Symptome wird oft auf andere Ursachen zurückgeführt. An die Möglichkeit einer Funktionsstörung der Nierentätigkeit wird selten bis überhaupt nicht gedacht. Doch Frühwarnsignale können sich in einer Untersuchung des Urins zeigen.
Viele Hausärzte kontrollieren die Nieren über eine Blutuntersuchung, wenn es sich um eine Routineuntersuchung handelt. Bei dieser Untersuchung wird der Kreatininwert überprüft.
Ein Betroffener sollte auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen, wenn sich die aufgezeigten Symptome bereits deutlich zeigen. Zumindest das Leitsymptom sollte nicht ignoriert werden. Wer sehr wenig oder übermäßig viel Urin produziert, sollte zu einem Arzt gehen. Zudem weiß der Betroffene selbst für gewöhnlich unter welchen diversen Krankheiten er leidet und welche Auswirkungen diese haben können.
Besteht das Wissen um eine Krankheit, so wird eine ärztliche Aufklärung darüber in der Regel bereits stattgefunden haben. Dies gilt im besonderen Maße in Hinsicht auf die Folgeerscheinungen einer bestehenden Krankheit, die eine Niereninsuffizienz zur Folge haben könnte.
Diagnose
Besteht der Verdacht auf eine Nierenstörung, so kann diese über einen Bluttest festgestellt werden. Der Bluttest stellt fest, ob die Nieren den Harn funktionsgemäß filtern. Liegt eine Insuffzizienz vor, so ist auch der Wert der glomerulären Filtrationsrate erniedrigt. Diese Rate gibt das gesamte Volumen des Primärharns an. Das Gesamtvolumen wird von beiden Nieren zusammen gebildet.
Der Test gibt außerdem sowohl Auskunft über die Entzündungswerte als auch Auskunft zum Kreatininwert.
Der Nachteil bei einer bloßen Blutuntersuchung mag sein, dass eine Schädigung der Nieren erst angezeigt wird, wenn mindestens fünfzig Prozent der funktionellen Tätigkeit der Nieren längst verloren sind. Daher ist es sinnvoll auch einen Mikroalbumintest machen zu lassen. Dieser Test konzentriert sich auf die Spuren von Eiweiß im Urin, die bei einer Störung der Nierentätigkeit schon früh im Krankheitsverlauf vorliegen.
Bei einer Verfestigung des Verdachts, ist es ratsam einen Spezialisten für Nierenerkrankungen aufzusuchen. Dabei handelt es sich um einen Nephrologen, der die Nierenstörung letztlich definitiv feststellen kann.
Behandlung & Therapie
Der Nephrologe wird bei der erforderlichen Behandlung und Therapie nach Art der Nierenerkrankung entscheiden. Nicht jeder Betroffene einer Nierenerkrankung wird direkt ein Dialysepatient. In zahlreichen Fällen eignen sich diverse Medikamente für eine medizinische Behandlung. Sind die Entzündungen in den Nieren bereits stark vorhanden, so verabreicht der Facharzt dem Patienten Glukokortikoide oder ein Immunsuppressivum. Diese Mittel helfen Entzündungsreaktionen im menschlichen Organismus zu unterdrücken.
Bei einer akuten Nierenschädigung besteht die Behandlung in einer Diät, die kochsalz- und proteinarm ist. In Kombination mit einer bilanzierten Flüssigkeitszufuhr und entsprechenden Medikamenten, werden auf diese Weise symptomatische Beschwerden effektiv gelindert.
Befindet sich der an einer Niereninsuffizienz Erkrankte bereits in einem fortgeschrittenen Krankheitsverlauf eines akuten Nierenversagens, so kann eine Dialyse unausweichlich werden. Bei einer Dialyse handelt es sich um eine künstliche Blutwäsche. In schwerwiegenden Fällen kann eine Nierentransplantation notwendig werden.
Die Therapie einer chronischen Niereninsuffizienz besteht überwiegend in der Vergabe von Medikamenten, beispielsweise gegen Bluthochdruck. Zudem werden Harnwegsinfekte behandelt und der Blutzuckerwert richtig eingestellt. Die Therapie ist darauf ausgerichtet das Fortschreiten der Nierenerkrankung zu verhindern. Der Patient selbst ist angehalten seine Lebensweise zu ändern.
Aussicht & Prognose
Eine chronische Nierenkrankheit kann nicht geheilt werden. Menschen, die an einer Nierenerkrankung leiden, tragen ein erhöhtes Risiko einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt zu bekommen. Besonders gefährdet sind Diabetiker und ältere Menschen.
Die Prognose hängt hier vom Verlauf der Nierenerkrankung ab, der ihr zugrunde liegenden Ursachen und Grunderkrankungen. Eine Prognose kann dann ausfallen, wenn die Nierenschwäche frühzeitig erkannt wird. Je früher die Krankheit erkannt wird, desto eher verbessern sich die Behandlungsmöglichkeiten.
Dennoch ist zu betonen, dass eine akute Nierenschwäche oftmals tödlich verläuft. Die eigentliche Todesursache ist dann auf die vorliegende auslösende Grunderkrankung zurückzuführen, wie beispielsweise ein Schock bei einer vorliegenden Sepsis oder einem Herzinfarkt. Die Prognose verschlechtert sich im Allgemeinen, wenn bereits auch andere Organe geschädigt sind.
Ein an einer Nierenschädigung erkrankter Körper ist besonders anfällig für Krankheitserreger. Die häufigste Todesursache sind demnach bestehende Infektionen.
Die Nierenfunktion kann sich aber nach einer akuten Nierenschwäche wieder erholen, wenn Flüssigkeits- und Blutverluste und der Blutdruck erfolgreich behandelt worden sind. In diesem Fall ist es möglich, dass die Nieren ihre Arbeit wieder aufnehmen können.
Im schwerwiegenden Fall eines Dialysepatienten ist eine Erholung der Nierenschwäche nicht mehr möglich. Die Dialyse bleibt ein lebenslanger Begleiter.
Die regelmäßige Einnahme von bereits verschriebenen Medikamenten ist notwendig für eine Verbesserung des Krankheitsverlaufs. Die jeweiligen ärztlichen Anweisungen sind strikt einzuhalten.
Vorbeugung
Eine Vorbeugung kann durch eine gesunde Lebensweise geschaffen werden. Dazu gehört nicht nur eine gesunde Ernährung, sondern auch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Mindestens zwei Liter am Tag sollte ein Mensch zu sich nehmen. Denn eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr hat sowohl für die Nieren als auch für die restlichen Organe große Bedeutung für ihr Funktionieren.
Neben einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr, sollten Salz oder Fett nur in Maßen mit der Nahrung aufgenommen werden. Auch sollte der Konsum von eiweißreichen Nahrungsmitteln eingeschränkt werden.
Wenn ein Betroffener bereits Medikamente wegen einer anderen Erkrankung einnimmt, ist darauf acht zu geben, dass sich diese nicht schädigend auf die Nieren auswirken. Ein Arzt kann dazu Auskunft geben und mögliche Alternativen nennen.
Nachsorge
Die Nachbehandlung ist abhängig von der Art und dem Schweregrad einer Nierenerkrankung. Planmäßige Nachuntersuchungen im Anschluss an eine vorläufig abgeschlossene oder beendete Therapie dienen dazu, Komplikationen oder Folgeschäden rechtzeitig zu erkennen und effektiv zu behandeln, eine Dauertherapie an den Krankheitsverlauf anzupassen und Betroffene beim Erhalt ihrer Lebensqualität zu unterstützen.
Bei chronischen Nierenerkrankungen, nach einer Nierentransplantation oder während einer Dialysebehandlung sind engmaschige Kontrolluntersuchungen notwendig. Zu den Maßnahmen der Nachsorge gehören Blutdruckkontrollen, Urintests, Kreatintests, die Überprüfung der Nierenfunktionswerte und Ultraschalluntersuchungen. Auch medizinischer Rehabilitationssport kann ein Bestandteil der Nachbehandlung sein.
Neben den regelmäßigen Nachsorgeuntersuchungen werden Patienten je nach Grad und Stadium einer Nierenerkrankung auch bei beruflichen oder psychischen Problemen beraten. In bestimmten Fällen kann beispielsweise eine psychotherapeutische Betreuung sinnvoll sein. In welchen Intervallen die Nachsorge stattfindet, bestimmt der behandelnde Arzt aufgrund des ursprünglichen Befundes. Zur Durchführung einer Weiterbehandlung führen Mediziner intensive Beratungsgespräche mit dem Patienten, um wichtige Hinweise zur Beachtung besonderer Details zu geben.
Bei einer Grunderkrankung oder einer Niereninsuffizienz ist ein dauerhafte Nachsorge nötig. Wichtig ist außerdem, dass Patienten mit Erkrankungen wie Diabetes zusätzliche Unterstützung erhalten, etwa in der Lebensstiländerung, um das Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme zu reduzieren. Alle Einzelheiten für eine Nachbehandlung bei Nierenerkrankungen bespricht der Arzt genauestens mit seinem Patienten.
Quellen
- Geberth, S., Nowack, R.: Praxis der Dialyse. Springer, Berlin 2014
- Keller, C.K., Geberth, S.K.: Praxis der Nephrologie. Springer, Berlin 2010
- Piper, W.: Innere Medizin. Springer, Berlin 2013
