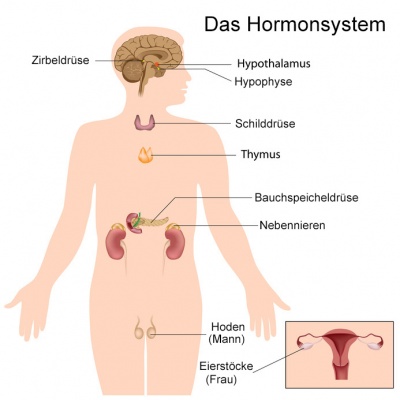Follikelstimulierendes Hormon (Follitropin)
 Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher
Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer. nat. Frank Meyer
Letzte Aktualisierung am: 26. Februar 2025Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.
Sie sind hier: Startseite Laborwerte Follikelstimulierendes Hormon (Follitropin)
Das Follikelstimulierende Hormon (Follitropin oder kurz FSH) gehört zu den Sexualhormonen. Bei einer Frau ist es für das Heranreifen der Eizelle bzw. für das Follikelwachstum, beim Mann für die Produktion von Spermien verantwortlich. Das FSH wird bei beiden Geschlechtern in der Hirnanhangsdrüse gebildet.
Was ist das Follikelstimulierendes Hormon?
Das Follikelstimulierende Hormon wird in der Hirnanhangsdrüse gebildet. Aufgrund seines Namens könnte vermutet werden, dass es ausschließlich bei einer Frau vorkommt; dem ist aber nicht so.
Das FSH wird zum Follikelwachstum, zur Follikelreifung und indirekt zur Eizellreifung benötigt. Männer benötigen FSH zur Spermienbildung (Spermatogenese), wenn auch in einer vergleichbar kleinen Menge. FSH ist damit unmittelbar für die Fruchtbarkeit beider Geschlechter wichtig. Ein FSH-Mangel kann zu Unfruchtbarkeit bzw. Zeugungsunfähigkeit führen.
Wofür braucht der Körper Follitropin?
Das follikelstimulierende Hormon (FSH), auch Follitropin genannt, ist ein essentielles Gonadotropin, das in der Hypophyse produziert wird und eine zentrale Rolle in der Regulation der Fortpflanzung spielt. Es steuert die Funktion der Geschlechtsorgane sowohl bei Frauen als auch bei Männern.
Bei Frauen ist FSH maßgeblich an der Reifung der Follikel in den Eierstöcken beteiligt. Während des Menstruationszyklus sorgt es in der frühen Follikelphase für das Wachstum und die Entwicklung der Eibläschen, die Östrogen produzieren. Der Anstieg des Östrogenspiegels trägt zur Reifung des dominanten Follikels bei, der später beim Eisprung freigesetzt wird. FSH ist somit entscheidend für die Fruchtbarkeit und beeinflusst die Qualität der Eizellen.
Bei Männern stimuliert FSH die Sertoli-Zellen in den Hoden, die für die Reifung und Entwicklung der Spermien verantwortlich sind. Es trägt zur Aufrechterhaltung der Spermatogenese bei und unterstützt die Produktion von androgenbindendem Protein (ABP), welches für eine optimale Testosteronwirkung in den Hoden sorgt.
Ein gestörter FSH-Spiegel kann zu Fruchtbarkeitsproblemen führen, beispielsweise durch unzureichende Follikelreifung bei Frauen oder eine verminderte Spermienproduktion bei Männern. Daher wird FSH auch in der Reproduktionsmedizin zur Behandlung hormoneller Störungen eingesetzt.
Produktion, Herstellung & Bildung
Der weibliche Monatszyklus wird durch das feine Zusammenspiel verschiedener Hormone gesteuert. Das FSH nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Zu Beginn eines neuen Zyklus produziert das Mittelhirn zunächst das Gonadotropine Releasing Hormon (kurz GnRH).
Das GnRH regt die Hypophyse zur Bildung von Luteotropin (kurz LH) und FSH an. Das FSH bewirkt die Reifung mehrere Follikel in den Eierstöcken der Frau. Es regt durch seine Tätigkeit die Östrogenbildung in den Follikeln an und aktiviert gleichzeitig das Tätigwerden von Zellen im Inneren des Follikels – den Granulosazellen – welche wiederum das in den Follikeln befindliche Eibläschen mit Nährstoffen versorgen.
Somit reifen Eizellen heran, welche unter bestimmten Voraussetzungen später befruchtet werden und zu einem Embryo heranwachsen können. Die Produktion von FSH stoppt in etwa am 10. Tag des weiblichen Zyklus, nämlich dann, wenn der Leitfollikel ein reifes Eibläschen in den Eileiter abgegeben hat (Eisprung).
Die Hirnanhangsdrüse eines Mannes schüttet kontinuierlich FSH – wenn auch in geringer Menge – aus. Im männlichen Körper stimuliert das FSH das Heranreifen von Spermien (Spermatogenese).
Funktion, Wirkung & Eigenschaften
FSH ist ein körpereigenes Hormon, welches in der Hirnanhangsdrüse gebildet wird. Es steht in unmittelbarerem Zusammenhang mit der Zeugungsfähigkeit eines Menschen, da es sowohl für das Heranreifen von befruchtungsfähigen Eizellen verantwortlich ist als auch für die Spermatogenese beim Mann.
Gesteuert wird die Produktion des FSH durch das ihm übergeordnete Hormon GnRH, welches im Mittelhirn produziert wird. Beim Mann bleibt die Produktion des FSH über sein gesamtes Leben hinweg in etwa konstant, d.h. die Hypophyse des geschlechtsreifen Mannes setzt kontinuierlich eine bestimmte Menge FSH frei.
Der Körper der Frau hingegen stellt etwa um das 50. Lebensjahr herum die Zeugungsfähigkeit ein (Menopause). In dieser Phase wird das Mittelhirn kein GnRH produzieren und folglich wird auch die Produktion des FSH weitgehend eingestellt. Eine Reifung von Follikeln und ein Eisprung sind dann nicht mehr möglich; auf natürlichem Wege kann eine Frau dann kein Kind mehr bekommen.
Mitunter kommt es vor, dass auch verhältnismäßig jungen Frauen kein FSH oder eine falsche Menge produzieren. Es kann sich dann weder ein Leitfollikel herausbilden noch ein Eisprung stattfinden. Eine Frau bemerkt das meist daran, dass ihre Regelblutung unregelmäßig oder gar nicht einsetzt, obwohl keine Schwangerschaft vorliegt. Häufig ist das fehlende FSH verantwortlich für das Polyzystische Ovar-Syndrom (PCO).
Hier bildet die Frau unzählige Follikel aus, aufgrund der niedrigen FSH-Konzentration wird aber kein Leitfollikel produziert. Ein Eisprung und eine Schwangerschaft sind dann nicht möglich. Im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung kann ein FSH-Mangel durch die Einnahme von Medikamenten (z.B. Monopräparat Fertavid®, Puregon®; Kombinationspräparat Pergoveris®) reguliert werden.
Wie hoch sind normale Referenzwerte
Die Referenzwerte für das follikelstimulierende Hormon (FSH) variieren je nach Geschlecht, Alter und Zyklusphase bei Frauen. Sie werden in Internationalen Einheiten pro Liter (IU/L) angegeben.
Bei Frauen schwankt der FSH-Wert im Laufe des Menstruationszyklus:
Follikelphase: etwa 3–12 IU/L
Ovulationsphase (Eisprung): etwa 8–22 IU/L
Lutealphase: etwa 1–7 IU/L
Postmenopause: etwa 25–135 IU/L
Nach den Wechseljahren steigen die FSH-Werte deutlich an, da die Eierstöcke weniger Östrogen produzieren und die negative Rückkopplung auf die Hypophyse entfällt.
Bei Männern bleibt der FSH-Wert relativ stabil und liegt typischerweise zwischen 1–10 IU/L. Er ist wichtig für die Spermatogenese und Hodenfunktion.
Bei Kindern sind die FSH-Werte vor der Pubertät niedrig (<4 IU/L), steigen jedoch mit dem Beginn der Pubertät an.
Abweichungen von den Referenzwerten können auf hormonelle Störungen hinweisen. Ein erhöhter FSH-Wert kann auf eine primäre Ovarialinsuffizienz oder eine gestörte Hodenfunktion hindeuten, während erniedrigte Werte auf eine Störung der Hypophyse oder des Hypothalamus hindeuten können. Die Messung erfolgt meist im Rahmen der Diagnostik von Fertilitätsproblemen oder hormonellen Erkrankungen.
Kann zu viel Follitropin schaden?
Ein übermäßig hoher Follitropin-(FSH)-Spiegel kann verschiedene negative Auswirkungen auf den Körper haben und auf zugrunde liegende gesundheitliche Probleme hinweisen. Da FSH eine zentrale Rolle in der Regulation der Fortpflanzung spielt, kann ein dauerhaft erhöhter Wert auf eine gestörte Funktion der Keimdrüsen hindeuten.
Bei Frauen ist ein hoher FSH-Wert oft ein Zeichen für eine verminderte Eierstockfunktion oder eine Ovarialinsuffizienz, wie sie bei den Wechseljahren oder vorzeitiger Menopause auftritt. Dies kann zu Unfruchtbarkeit, unregelmäßigem Zyklus oder dem vollständigen Ausbleiben der Menstruation führen. Bei einer künstlichen Hormonstimulation in der Kinderwunschbehandlung kann ein zu hoher FSH-Spiegel das Risiko eines ovariellen Überstimulationssyndroms (OHSS) erhöhen, das mit Flüssigkeitsansammlungen, vergrößerten Eierstöcken und in schweren Fällen mit Thrombosen oder Organschäden einhergehen kann.
Bei Männern kann ein erhöhter FSH-Wert auf eine Hodenschädigung hinweisen, beispielsweise durch genetische Erkrankungen (z. B. Klinefelter-Syndrom), Chemotherapie oder Infektionen wie Mumpsorchitis. Eine hohe FSH-Konzentration kann mit einer verminderten Spermienproduktion einhergehen und zu Unfruchtbarkeit führen.
Bei Kindern kann ein frühzeitig erhöhter FSH-Wert auf eine vorzeitige Pubertät hindeuten. Da ein zu hoher FSH-Spiegel meist eine Folgeerkrankung widerspiegelt, sollte immer eine medizinische Abklärung erfolgen, um die Ursache zu identifizieren und gegebenenfalls zu behandeln.
Kann zu wenig Follitropin schaden?
Ein zu niedriger Follitropin-(FSH)-Spiegel kann erhebliche Auswirkungen auf die Fortpflanzungsfähigkeit und die hormonelle Balance haben. Da FSH essenziell für die Steuerung der Keimdrüsen ist, kann ein Mangel zu Problemen bei der Reifung von Eizellen und Spermien führen.
Bei Frauen kann ein niedriger FSH-Wert darauf hindeuten, dass die Hypophyse oder der Hypothalamus nicht ausreichend Hormone produziert (hypogonadotroper Hypogonadismus). Dies kann zu Zyklusstörungen, ausbleibender Menstruation (Amenorrhoe) und Unfruchtbarkeit führen. Ursachen sind unter anderem starkes Untergewicht, chronischer Stress, übermäßiger Sport oder Erkrankungen wie das Polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS). Eine unzureichende FSH-Produktion verhindert die normale Follikelreifung und die Östrogenproduktion, was auch das Risiko für Osteoporose erhöht.
Bei Männern führt ein zu niedriger FSH-Wert zu einer eingeschränkten Spermienproduktion (Oligo- oder Azoospermie), was Unfruchtbarkeit zur Folge haben kann. Dies kann durch hormonelle Störungen, Tumore im Hypothalamus-Hypophysen-System oder durch übermäßige Testosteron-Zufuhr (z. B. durch Anabolika) verursacht werden.
Bei Kindern kann ein niedriger FSH-Spiegel auf eine verzögerte oder ausbleibende Pubertät hindeuten. Ein Mangel an FSH kann das Wachstum der Geschlechtsorgane beeinträchtigen und die sexuelle Reifung verzögern. In solchen Fällen ist eine medizinische Abklärung notwendig, um eine mögliche Hormontherapie in Betracht zu ziehen.
Krankheiten, Beschwerden & Störungen
Augenscheinlichstes Krankheitsbild einer an FSH-Mangel leidenden Frau ist ihre Sterilität, ihre häufigste Beschwerde ein unregelmäßiger Monatszyklus.
Liegt eine FSH-Unterproduktion vor, so reifen im Körper zwar Follikel heran. Sie werden aber nicht vollständig ausgebildet und es vermag kein Follikel die Leitfunktion zu übernehmen (Polyzystisches Ovar-Syndrom). Die Folge ist ein gestörter Monatszyklus, da weder ein Eisprung noch das Ausbilden und anschließende Abbluten einer Gebärmutterschleimhaut sattfinden kann.
Die Frau bemerkt an sich eine unregelmäßige Blutung bis hin zum kompletten Ausbleiben über mehrere Monate hinweg, ohne das eine Schwangerschaft vorliegt. Da ein Eisprung entweder unregelmäßig oder gar nicht sattfindet, ist die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, gering bzw. nicht vorhanden. Frauen mit PCO bzw. FSH-Mangel können im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung dennoch ein Kind bekommen.
Über Medikamente (z.B. Puregon®) kann der FSH-Mangel ausgeglichen werden, so dass die Frau entweder selbst einen Eisprung hat oder aber genügend befruchtungsfähige Eizellen heranreifen lässt, dass im Anschluss eine IVF vorgenommen werden kann. Bei unregelmäßigem Zyklus und Kinderwunsch ist ein Arztbesuch immer angezeigt.
Tipps für eine optimale Versorgung mit Follitropin
Ausgewogene Ernährung
Eine nährstoffreiche Ernährung mit ausreichend Proteinen, gesunden Fetten und komplexen Kohlenhydraten unterstützt die Hormonproduktion. Besonders wichtig sind Zink, Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren, die zur Regulierung des Hormonhaushalts beitragen.
Ausreichende Kalorienzufuhr
Untergewicht oder eine zu geringe Kalorienaufnahme kann die Hormonproduktion hemmen und zu einem niedrigen FSH-Spiegel führen. Eine ausreichende Energiezufuhr ist essenziell für eine gesunde Funktion der Hypophyse.
Regelmäßige Bewegung
Moderate körperliche Aktivität, insbesondere Krafttraining und Ausdauersport, kann die Hormonbalance verbessern. Exzessiver Sport, insbesondere Ausdauersport mit hoher Intensität, kann jedoch die FSH-Produktion senken.
Stressmanagement
Chronischer Stress erhöht den Cortisolspiegel, was sich negativ auf die Gonadotropin-Freisetzung auswirken kann. Entspannungstechniken wie Meditation, Yoga oder Atemübungen helfen, das hormonelle Gleichgewicht zu bewahren.
Gesunder Schlaf
Eine gute Schlafqualität und ausreichende Schlafdauer (7–9 Stunden pro Nacht) sind wichtig, da die Hormonregulation während der Nacht erfolgt. Schlafmangel kann die Hypophysenfunktion und damit die FSH-Produktion beeinträchtigen.
Vermeidung von Umweltgiften und endokrinen Disruptoren
Chemikalien in Plastik, Pestiziden und Kosmetika (z. B. Bisphenol A, Phthalate) können das endokrine System stören und die FSH-Produktion beeinflussen. Der Konsum von biologischen Lebensmitteln und die Verwendung natürlicher Pflegeprodukte kann das Risiko minimieren.
Ausgewogener Alkoholkonsum und Nikotinverzicht
Alkohol und Nikotin können die Hypophysenfunktion und somit die FSH-Ausschüttung beeinträchtigen. Ein maßvoller Umgang mit Alkohol und der Verzicht auf Rauchen tragen zur hormonellen Gesundheit bei.
Optimierung der Schilddrüsenfunktion
Eine unbehandelte Schilddrüsenunterfunktion kann den FSH-Spiegel senken, da die Schilddrüsenhormone eng mit der Hypophysenfunktion verknüpft sind. Eine regelmäßige Kontrolle der Schilddrüsenwerte kann helfen, hormonelle Ungleichgewichte zu vermeiden.
Regelmäßige hormonelle Checks
Wer unter Zyklusstörungen, Unfruchtbarkeit oder anderen hormonellen Beschwerden leidet, sollte regelmäßig die Hormonwerte, einschließlich FSH, überprüfen lassen. Eine frühzeitige Erkennung von Ungleichgewichten erleichtert eine gezielte Therapie.
Gezielte Hormontherapie bei Mangel
Falls ein medizinisch relevanter FSH-Mangel festgestellt wird, kann eine gezielte Hormontherapie mit Follitropin notwendig sein. Diese sollte jedoch nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen, insbesondere in der Kinderwunschbehandlung oder bei hormonellen Störungen.
Quellen
- Braun, J., Dormann, A .J.: Klinikleitfaden Innere Medizin. Urban & Fischer, München 2013
- Clark, D.P.: Molecular Biology: Das Original mit Übersetzungshilfen. Spektrum Akademischer Verlag., Heidelberg 2006
- Marischler, C.: BASICS Endokrinologie. Urban & Fischer, München 2013